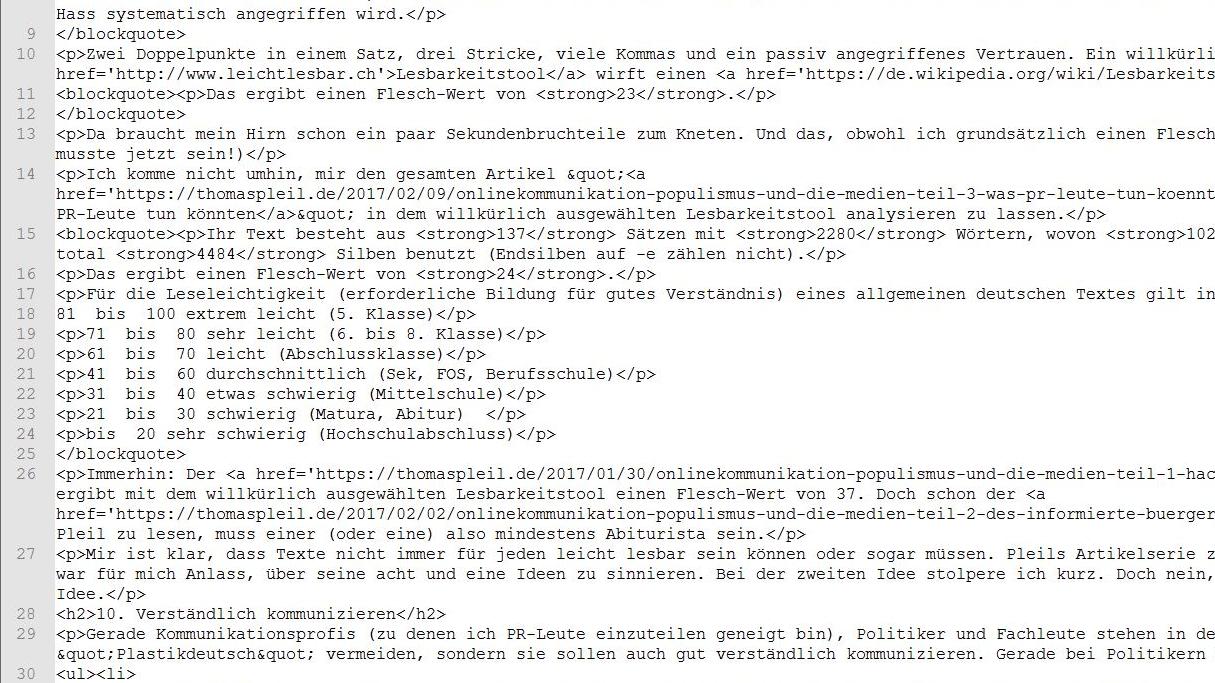Ein subjektiv-komplizierter Text, nicht recherchiert, und aus dem Bauch heraus geplappert.
Bei schwierigem und kompliziertem Text kommt es schon mal zu Widersprüchen oder Fehlern. Das erfordert aktives Beschäftigen mit dem Text. Oder das Komplizierte wird einfach nicht verstanden, weil Viele nur einfach verstehen.
Wer etwas nicht versteht, der wird dem Urheber des Komplizierten nicht vertrauen. Wer leicht, sehr leicht oder sogar extrem leicht schreibt, der wird verstanden. Wer verstanden wird, und wer einfache Lösungen postuliert, dem wird vertraut. Denn wenn das Postulierte nicht eintritt, dann war es die Schuld von anderen. Denn es ist ja ganz einfach.
Vielleicht ist es also tatsächlich ganz einfach, warum Demagogen und Populisten so schnell und so verbreitet auf dem Vormarsch sind. Nicht nur das Vertrauen in argumentative, begründete und ausgewogene Texte und sonstige Inhalte sinkt nach meinem Eindruck. Auch das Vertrauen in Menschen, die derart schreiben und reden, sinkt.
Machen wir uns nichts vor: Ein Großteil der Bevölkerung in den „entwickelten Ländern“ wie USA oder Deutschland versteht nur leicht verständlichen Text. Viele Politiker und Experten, die an sich begründet und ausgewogen zu einem Urteil kommen mögen, jedoch schwafeln verschachtelte Text (so wie ich jetzt) und halten mehrstündige Reden. Fachwörter, Passivformen und umgekehrter Satzbau sind weitere Nägel auf den Sarg der Verständlichkeit. Meine Lehrer brachten mir in der Schule“SPO“ bei: Subjekt – Prädikat – Objekt. Fertig. Heutzutage ist „OPS“, kombiniert mit Passivformen und verschachtelten Sätzen, Nebensätzen, Einklammerungen und wasweißichallesnichtnoch, in Mode. Hört Euch nur mal die Nachrichten in Fernsehen und Hörfunk mit ihren Passivista (Evangelisten der Passivformen) an.
Und dann lese ich auch noch solche „Konstrukte“:
Denn: Demokratie lebt von Vertrauen: Zum Beispiel dem Vertrauen, dass Politiker nicht vornehmlich ihre eigenen Interessen, sondern die der Bürger vertreten, oder dem Vertrauen darauf, persönlich vorankommen zu können, fair bezahlt zu werden, im Alter abgesichert zu sein – egal ob Mann oder Frau, und natürlich lebt die Demokratie auch nur, wenn Vertrauen in ihre Institutionen, in die Medien und – natürlich – die Wirtschaft besteht und auf der anderen Seite solches Vertrauen nicht durch Lügen, Verschwörungstheorien oder Hass systematisch angegriffen wird.
Zwei Doppelpunkte in einem Satz, drei Stricke, viele Kommas und ein passiv angegriffenes Vertrauen. Ein willkürlich ausgewähltes Lesbarkeitstool wirft einen Flesch-Lesbarkeitsindex aus:
Das ergibt einen Flesch-Wert von 23.
Da braucht mein Hirn schon ein paar Sekundenbruchteile zum Kneten. Und das, obwohl ich grundsätzlich einen Flesch-Wert von weniger als 21 zu ertragen geeignet sein könnte (das musste jetzt sein!)
Ich komme nicht umhin, mir den gesamten Artikel „Onlinekommunikation, Populismus und die Medien – Teil 3: Was PR-Leute tun könnten“ in dem willkürlich ausgewählten Lesbarkeitstool analysieren zu lassen.
Ihr Text besteht aus 137 Sätzen mit 2280 Wörtern, wovon 1024 verschiedene. Sie haben total 4484 Silben benutzt (Endsilben auf -e zählen nicht).
Das ergibt einen Flesch-Wert von 24.
Für die Leseleichtigkeit (erforderliche Bildung für gutes Verständnis) eines allgemeinen deutschen Textes gilt in der Regel:
81 bis 100 extrem leicht (5. Klasse)71 bis 80 sehr leicht (6. bis 8. Klasse)
61 bis 70 leicht (Abschlussklasse)
41 bis 60 durchschnittlich (Sek, FOS, Berufsschule)
31 bis 40 etwas schwierig (Mittelschule)
21 bis 30 schwierig (Matura, Abitur)
bis 20 sehr schwierig (Hochschulabschluss)
Immerhin: Der erste Artikel der Serie ergibt mit dem willkürlich ausgewählten Lesbarkeitstool einen Flesch-Wert von 37. Doch schon der zweite Artikel sinkt auf einen Wert von 22. Um Thomas Pleil zu lesen, muss einer (oder eine) also mindestens Abiturista sein.
Mir ist klar, dass Texte nicht immer für jeden leicht lesbar sein können oder sogar müssen. Pleils Artikelserie zielt wohl kaum auf Schüler in der fünften Klasse. Doch sein Text war für mich Anlass, über seine acht und eine Ideen zu sinnieren. Bei der zweiten Idee stolpere ich kurz. Doch nein, sie greift nicht ganz das, was mir fehlt. Es fehlt die zehnte Idee.
10. Verständlich kommunizieren
Gerade Kommunikationsprofis (zu denen ich PR-Leute einzuteilen geneigt bin), Politiker und Fachleute stehen in der Verantwortung, verstanden zu werden. Sie sollen nicht nur „Plastikdeutsch“ vermeiden, sondern sie sollen auch gut verständlich kommunizieren. Gerade bei Politikern sehe ich eine Schere:
- Entweder sie kommunizieren zu einfach, zu reduziert und zu kurz. Wenn dann auch noch alternativ oder nicht faktische Falschheit dazu kommt, entsteht jemand wie Trump.
- Oder sie kommunizieren zu kompliziert, zu ausufernd und zu lang. Wenn dann auch noch alternativ oder nicht faktische Falschheit dazu kommt, entsteht jemand wie … Castro oder Honecker vielleicht.
Kommunikationsprofis neigen zum Ersten, Fachleute neigen zum Zweiten. Politiker neigen entweder zum Ersten oder zum Zweiten, wobei sie oft weder das Erste noch das Zweite sind.
PR-Leute bzw. Kommunikationsprofis, Politiker und Fachleute sollten gut verständlich und mit ausgewogener Argumentation kommunizieren, um Polarisierung entgegenzuwirken, Vertrauen zu schaffen und damit das öffentliche Klima zu verbessern.
P.S.: Sind Lehrer eigentlich auch Kommunikationsprofis?
P.P.S.: Bis zum „P.S.“ komme ich mit dem willkürlich ausgewählten Lesbarkeitstool immerhin auf einen Flesch-Wert von 42. Und das, obwohl ein Zitat von einem PR-Mann und Kommunikationsprofi enthalten ist.